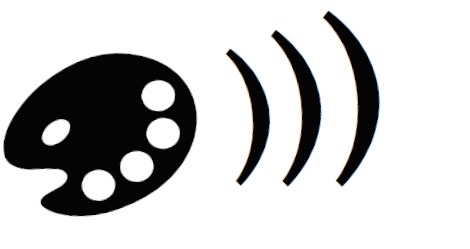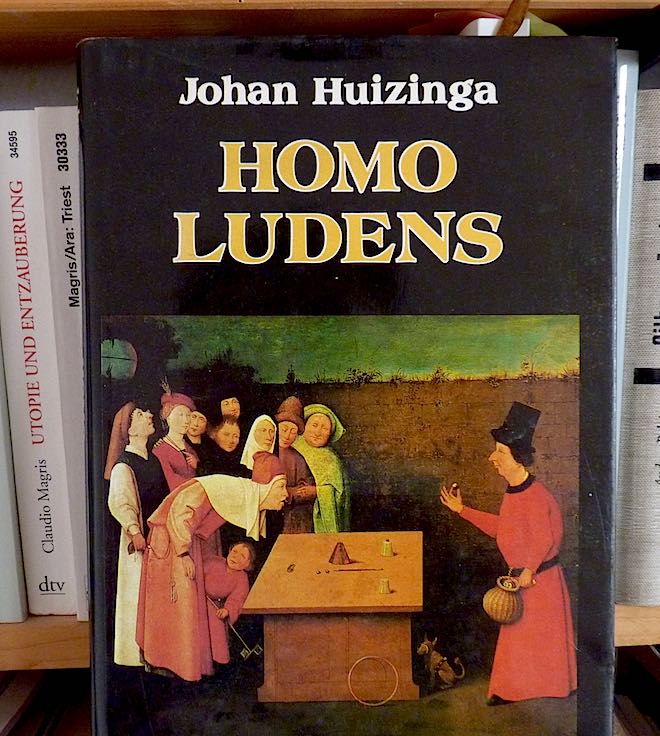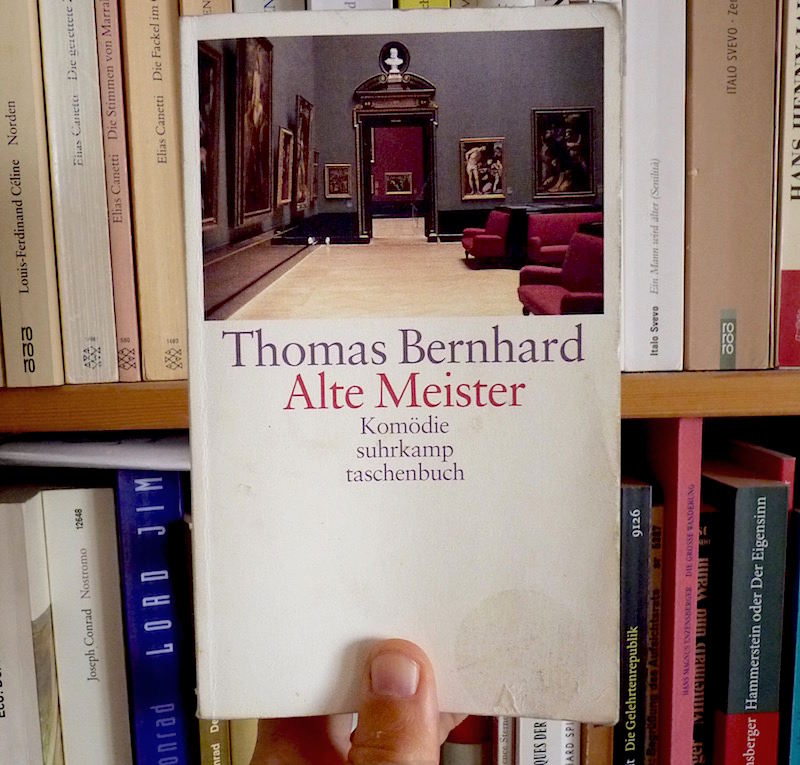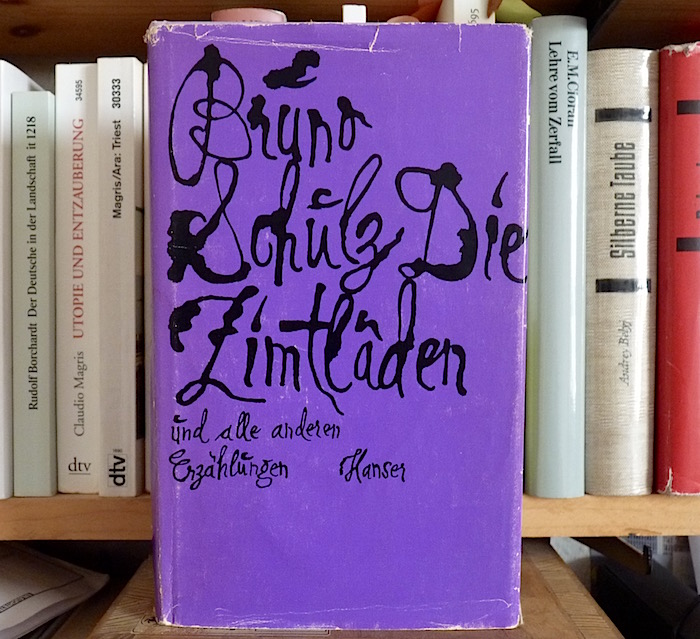Beate förderte mich neulich auf, im Blog wieder eine Buchempfehlung zu geben. Nun mache ich sie – und zwar eine ganz besondere! Denn ich darf heute mein eigenes Buch empfelen! Seit gestern, druckfrisch, liegt es vor.
DIE ARCHITEKTUR DER ZERBRÖSELUNG
Über die paradoxe Unverwundbarkeit der Schönheit
Der Untertitel verrät, worüber ich geschrieben habe. Die Schönheit – ein Thema, das mit Kunst und Malerei einiges zu tun hat …
Hier der Klappentext.
Der Autor zog sich während der Sommermonate des Jahres 2013 in seinen Garten, ein kleines Naturrefugium inmitten der schwäbischen Hauptstadt, zurück, um ein wahrhaftig gewagtes »avantgardistisches« Unterfangen zu beginnen: Er wollte nicht weniger, als ein für alle Mal das Rätsel der Schönheit zu lösen. Aber damit nicht genug! Der Avantgardekünstler möchte seinem Unterfangen noch eine literarische Probe beifügen, die das Geheimnis der Schönheit lüftet und zugleich artistisch demonstriert. [read more=“weiter lesen“ less=“weniger lesen“]Die »Architektur der Zerbröselung« ist von einem nach Ausdruck und Tiefe gierenden, aber wohltemperierten Atmungsrhythmus durchzogen. Der Text verdichtet sich in luzide, beinahe parodistische Reflexionen über Gesellschaft und Kultur, über Alltag und Kunst. Der Autor betreibt eine satirische Kunstkritik, deutet Zeichen am Himmel und auf der Erde, holt Luft für eine scharfe Betrachtung eines »Artefakts« seiner Umgebung, aber letztendlich doch nur, um dadurch angestaute Energie auf der schwalbenartigen Flugbahn seiner poetischen Bilder in der Besinnung auf das Hier und Jetzt in der unabänderlichen Einfachheit des Augenblicks aufzulösen. In der tiefen Stille solcher Augenblicke stellt der verblüffte Künstler das Paradoxe einer »wahren« Schönheit fest: Sie ist mit unzähligen Narben übersät – und trotzdem unverwundbar, sie ist ein Paradoxon und somit (scheinbar) unergründlich. Aber wie fällt ihr Urteil, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über sie reden? Die Brust des Erzählers setzt erneut zu einem tiefen Einatmen an und der Text füllt sich mit neuer Spannung. Bis zum letzten Satz dieses wundersamen Buches ringen das Herz und der Kopf um die Vorherrschaft über das literarische Atmungsorgan des Autors und liefern 190 Seiten Schönheit – samt ihres Rätsels Lösung![/read]
Das Buch ist im Verlag Edition Randgruppe erschienen und ist – außer dort und im Buchhandel – exklusiv für die Blogleser auch hier erhältlich! Ihr könnt es formlos per E-Mail (atelier@mislissippi.com) bei mir bestellen oder in unserem Atelier direkt erwerben.
Die Architektur der Zerbröselung
190 Seiten; Softcover; Euro 14,-
ISBN 978-3-9816926-3-1
Views: 100